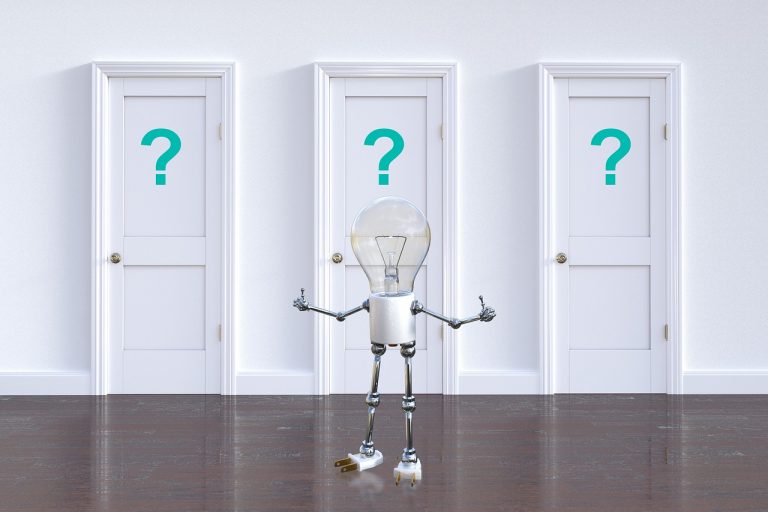„Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ – diese Aussage hat sich im antifaschistischen Diskurs ebenso etabliert wie das Toleranzparadoxon. Warum diese Argumente ins Leere laufen und was wir daraus lernen können, möchte ich in diesem Artikel beleuchten.
„Keine Meinung, sondern ein Verbrechen“
Die Parole „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ soll klarstellen, dass Faschismus keine akzeptable Idee oder Position ist. Man soll sie kategorisch ablehnen, und kategorisiert sie ein im Bereich der Unmoral, der Illegalität.
Wo die Prämisse scheitert:
- Der Staat als Maßstab
Die Parole stellt Faschismus als „Verbrechen“ dar, doch diese Kategorisierung hängt vollständig davon ab, was der Staat als strafwürdig einstuft. Das entpolitisiert Faschismus und reduziert ihn auf eine Meinungsäußerung, die lediglich aufgrund staatlicher Regeln als „böse“ gilt. Seine eigentliche Dimension als umfassendes, organisiertes politisches Projekt wird ignoriert. Und: Der Staat selbst nimmt sich aus der Schussbahn, weil er sich selbst nicht kriminalisiert. - Orientierung am Faschismusbegriff der 1930er
Faschismus wird in der gängigen Darstellung primär mit den Gräueltaten des NS-Regimes gleichgesetzt. Das Verbrechen des Faschismus ist so nicht das Programm, sondern die Historie. Moderne rechte Parteien berufen sich aber weniger auf die Vorgänger, sehen sich nicht in der Nachfolge des dritten Reichs. Vielmehr wirbt sie damit: „Wir sind die Union von vor 30 Jahren.“ - Immunisierung der freiheitlich demokratischen Grundordnung
Weil die BRD Faschismus historisch verankert und sich selbst als Gegenpol definiert, bleiben faschistische Elemente in heutigen staatlichen Strukturen und Methoden unsichtbar. Das staatliche Narrativ des entnazifizierten Deutschland wird verstärkt. ein weiterführendes Hinterfragen ist unerwünscht. Wir sehen nicht, wo wir die Grundlage für faschistisches Denken legen. Das verhindert die effektive Bekämpfung rechter Bewegungen. Faschismus wird zu dem, was die anderen tun oder getan haben.
Wie sieht es mit dem anderen Argument aus?
Das Toleranzparadoxon
„Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz“, schrieb Karl Popper.
Dieses Toleranzparadoxon begründet die Notwendigkeit staatlicher Gewalt oder gesellschaftlichem Ausschluss gegen Intolerante. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass diese Anwendung des Paradoxons vielmehr mit der Legitimation bestehender Machtstrukturen zu tun hat.
Wo die Prämisse scheitert:
- Verweigerung des rationalen Diskurses
Popper nennt die Verweigerung eines rationalen Diskurses als Kriterium für Intoleranz. Doch „Mit Rechten redet man nicht“ drückt klar aus, dass demokratische Antifaschist*innen den Diskurs verweigern. Rechte nutzen genau diese Argumentation: „Ihr seid intolerant uns gegenüber, verweigert den Diskurs und behandelt uns nicht rational.“ Das Paradoxon drängt also im Grunde die Medien dazu, Faschist*innen eine Bühne zu bieten. - Kriminalisierung und Gewalt
Popper nennt außerdem die Anwendung von Gewalt gegen Andersdenkende als Intoleranzkriterium. Doch der Staat selbst übt regelmäßig Gewalt aus. Zum Beispiel gegen „intolerante“ Gruppen wie rechte Bewegungen oder gegen Klimaaktivist*innen. Aber da soll das Argument nicht gelten. Rechte nutzen diesen Widerspruch, um zu sagen: „Die Gewalttätigen sind die Etablierten.“Das Paradoxon stellt die bestehende Gewalt nicht in Frage, und legitimiert daher auch die Gewalt der anderen. - Der Status Quo bleibt unangetastet
Die Anwendung des Paradoxons dient primär der Verteidigung des Status Quo. Das schützt nicht die Opfer des Faschismus. Es schützt die bestehenden Machtstrukturen – auch wenn diese faschistische Elemente enthalten. Das Paradoxon ignoriert, dass der Staat die Regeln definiert und legitimiert, wer toleriert werden darf und wer nicht.
Rückblick
Ein Blick in die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, warum das Argument in der Praxis scheitert. Abschiebungen, Hinrichtungen und Brechmittelfolter, das sind Beispiele, die im Verlaufe der Geschichte der BRD demokratisch legitim durchgeführt wurden und zum Teil immer noch werden.
Die aktuellen rechten Parteien berufen sich auf diese Historie systemischer Gewalt. Wie auch schon beim anderen Argument machen sie klar, dass sie Demokrat*innen sind. Als Demokrat kommt man nun in eine Zwickmühle. Entweder man erkennt die Rechten als Demokraten an. Oder man gibt das Narrativ der entnazifizierten BRD auf.
Das Paradoxon schützt nicht vor Faschismus. Es schützt den Status Quo und lenkt ab von der Frage, wie tief faschistische Dynamiken in unsere Strukturen eingebettet sind.
Fazit
Die besprochenen Argumente sind ineffektiv gegen Faschismus. Schlagworte wie „ewiggestrig“ werden dem aktuellen Diskurs nicht gerecht. Sie lenken von faschistischen Dynamiken im bestehenden System ab und stärken den Status Quo. Die neue Rechte nutzt diese Schwächen gezielt aus und gewinnt so an Stärke.
Antifaschismus muss diese Lücke schließen. Durch die kritische Auseinandersetzung mit den Strukturen, die Faschismus überhaupt erst ermöglichen. Antifaschismus beginnt bei uns. Fragen wir uns: War die Entnazifizierung wirklich vollständig? Wo trage ich selbst noch Denkstrukturen mit, die faschistische Elemente ermöglichen?
Ich wünsche dir einen friedlichen Tag.